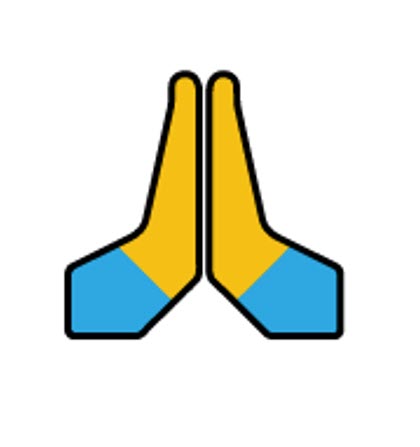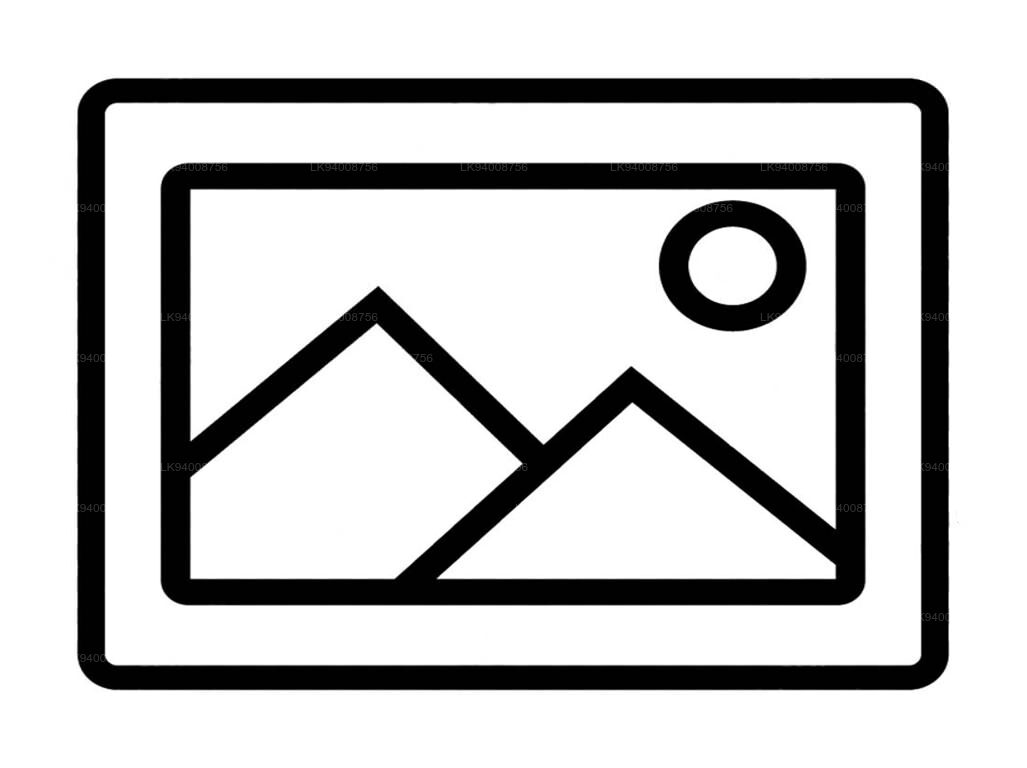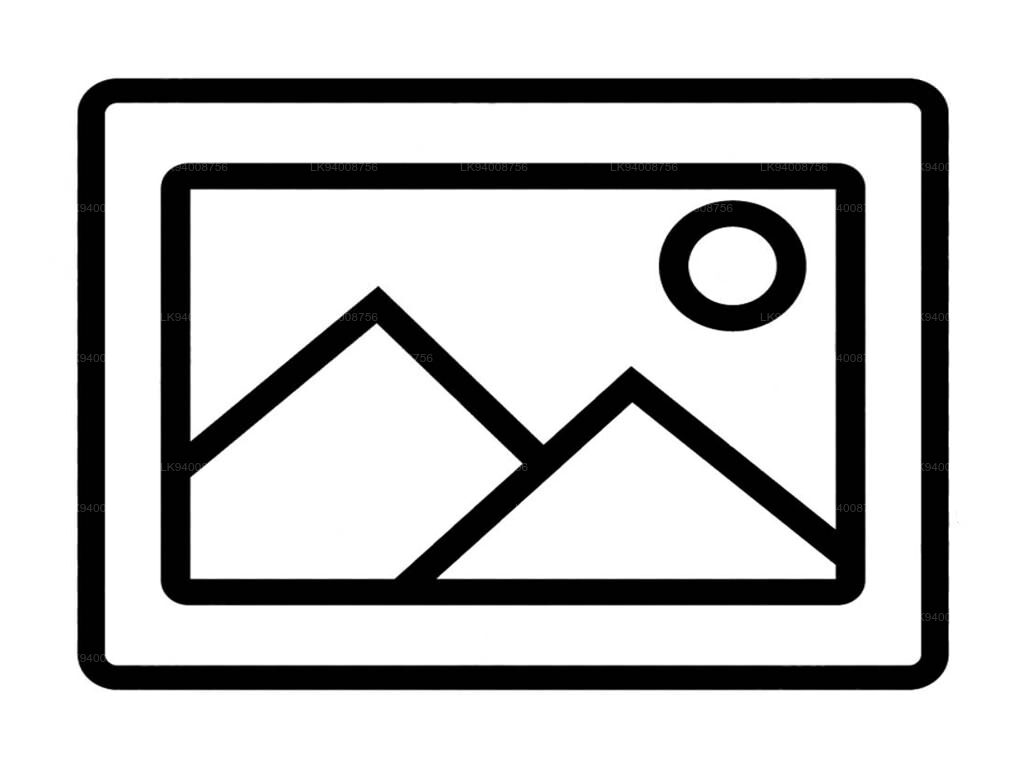Nirvana (Nibbana)
Nirvana (निर्वाण, Sanskrit: nirvāṇa; Pali: nibbana , nibbāna) ist das Ziel des buddhistischen Weges. Die wörtliche Bedeutung des Begriffs ist „Ausblasen“ oder „Abschrecken“. Nirvana ist das ultimative spirituelle Ziel im Buddhismus und markiert die soteriologische Befreiung von Wiedergeburten im Saṃsāra. Nirvana ist Teil der Dritten Wahrheit über das „Aufhören von Dukkha“ in den Vier Edlen Wahrheiten und das höchste Ziel des Edlen Achtfachen Pfades.
In der buddhistischen Tradition wurde Nirvana allgemein als das Aussterben der „drei Feuer“ oder „drei Gifte“,[Anmerkung 1] Gier (raga), Abneigung (dvesha) und Unwissenheit (moha) interpretiert. Wenn diese Feuer gelöscht sind, wird die Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburt (saṃsāra) erreicht.
Einige Gelehrte behaupten auch, Nirvana sei mit den Zuständen Anatta (Nicht-Selbst) und Sunyata (Leere) identisch, obwohl dies von anderen Gelehrten und praktizierenden Mönchen heftig bestritten wird. Im Laufe der Zeit, mit der Entwicklung der buddhistischen Lehre, wurden andere Interpretationen gegeben, wie zum Beispiel das Fehlen des Webens (Vana) der Aktivität des Geistes, die Beseitigung des Verlangens und die Flucht aus dem Wald, vgl. die fünf Skandhas oder Aggregate. Die buddhistische schulische Tradition unterscheidet zwei Arten von Nirvana: Sopadhishesa-Nirvana (Nirvana mit Rest) und Parinirvana oder Anupadhishesa-Nirvana (Nirvana ohne Rest oder endgültiges Nirvana). Es wird angenommen, dass der Begründer des Buddhismus, Buddha, beide Zustände erreicht hat.
Nirvana oder die Befreiung von den Zyklen der Wiedergeburt ist das höchste Ziel der Theravada-Tradition. In der Mahayana-Tradition ist das höchste Ziel die Buddhaschaft, bei der es kein Verweilen im Nirvana gibt. Buddha hilft, Wesen von Saṃsāra zu befreien, indem er den buddhistischen Weg lehrt. Für Buddha oder Menschen, die das Nirvana erreichen, gibt es keine Wiedergeburt. Aber seine Lehren bleiben für eine gewisse Zeit in der Welt als Leitfaden zum Erreichen des Nirvana.
Hintergrund
Das Konzept des Nirvana ist auch in älteren indischen Religionen präsent, darunter in der vedischen Kultur , im Hinduismus und im Jainismus. Es ist auch im Sikhismus und Manichäismus präsent.
Etymologie
Der Ursprung des Begriffs Nirvana ist wahrscheinlich vorbuddhistisch. Es war ein mehr oder weniger zentrales Konzept bei den Jains, den Ajivikas, den Buddhisten und bestimmten hinduistischen Traditionen. Es beschreibt im Allgemeinen einen Zustand der Freiheit von Leiden und Wiedergeburt. Die Ideen der spirituellen Befreiung finden sich unter Verwendung unterschiedlicher Terminologie in alten Texten nicht-buddhistischer indischer Traditionen, beispielsweise in Vers 4.4.6 der Brihadaranyaka-Upanishad des Hinduismus. Der Begriff wurde möglicherweise mit einem Großteil seiner semantischen Reichweite aus diesen anderen sramanischen Bewegungen in den Buddhismus importiert. Die Etymologie ist jedoch möglicherweise nicht aussagekräftig für seine Bedeutung.
Bedeutung
Befreiung und Befreiung vom Leiden; Moksha, Vimutti;
Nirvana wird synonym mit Moksha (Sanskrit), auch Vimoksha, oder Vimutti (Pali), „Erlösung, Befreiung vom Leiden“, verwendet. Im Pali-Kanon werden zwei Arten von Vimutti unterschieden:
Ceto-vimutti, Freiheit des Geistes; es ist die qualifizierte Freiheit vom Leiden, die durch die Praxis der Konzentrationsmeditation (Samādhi) erreicht wird. Vetter übersetzt dies als „Befreiung des Herzens“, was bedeutet, das Verlangen zu überwinden und dadurch einen wunschlosen Lebenszustand zu erreichen.
Pañña-vimutti, Freiheit durch Verständnis (prajña); Es ist die endgültige Befreiung vom Leiden und das Ende der Wiedergeburt, die durch die Praxis der Einsichtsmeditation (Vipassanā) erreicht wird.
Ceto-Vimutti wird erst mit der Erlangung von Pañña-Vimutti dauerhaft. Laut Gombrich und anderen Gelehrten handelt es sich möglicherweise um eine spätere Entwicklung innerhalb des Kanons, die eine wachsende Betonung von Prajña im frühen Buddhismus anstelle der befreienden Praxis von Dhyana widerspiegelt. es könnte auch eine erfolgreiche Integration nicht-buddhistischer Meditationspraktiken im alten Indien in den buddhistischen Kanon widerspiegeln. Laut Anālayo wird der Begriff uttari-vimutti (höchste Befreiung) in den frühen buddhistischen Texten auch häufig verwendet, um die Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburt zu bezeichnen.
Aussterben und Ausblasen
Eine wörtliche Interpretation übersetzt nir√vā als „ausblasen“, wobei nir negativ zu interpretieren ist, und va als „blasen“. Dies gibt die Bedeutung von „ausblasen“ oder „auslöschen“. Es bezieht sich sowohl auf die Handlung als auch auf die Wirkung des Blasens (auf etwas), um es zu löschen, aber auch auf den Prozess und das Ergebnis des Ausbrennens, des Erlöschens. Der Begriff Nirvana im soteriologischen Sinne von „ausgeblasener, erloschener“ Zustand der Befreiung kommt weder in den Veden noch in den vorbuddhistischen Upanishaden vor. Laut Collins „scheinen die Buddhisten die ersten gewesen zu sein, die es Nirvana nannten.“
Der Begriff Nirvana wurde dann Teil einer umfangreichen metaphorischen Struktur, die sich wahrscheinlich schon in sehr jungen Jahren im Buddhismus etablierte. Laut Gombrich bezieht sich die Zahl der drei Feuer auf die drei Feuer, die ein Brahmane am Brennen halten musste, und symbolisierte so das Leben in der Welt als Familienvater. Die Bedeutung dieser Metapher ging im späteren Buddhismus verloren und es wurden andere Erklärungen für das Wort Nirvana gesucht. Nicht nur Leidenschaft, Hass und Täuschung sollten ausgelöscht werden, sondern auch alle Krebsarten (Asava) oder Verunreinigungen (Khlesa). Spätere exegetische Arbeiten entwickelten eine ganze Reihe neuer volksetymologischer Definitionen des Wortes Nirvana, wobei die Wurzel vana für „blasen“ verwendet wurde, das Wort jedoch in Wurzeln umgewandelt wurde, die „Weben, Nähen“, „Verlangen“ und „ Wald oder Wälder“:
vâna, abgeleitet vom Wurzelwort √vā, was „blasen“ (Wind) bedeutet; sondern auch (einen Geruch) abgeben, sich ausbreiten oder verbreiten; Nirvana bedeutet dann „ausblasen“; vāna, abgeleitet von der Wurzel vana oder van, die „Verlangen“ bedeutet, wird Nirvana dann als ein Zustand von „ohne Verlangen, ohne Liebe, ohne Wunsch“ und einem Zustand ohne Verlangen oder Durst (taṇhā) erklärt; Hinzufügen der Wurzel √vā, was „weben oder nähen“ bedeutet; Nirvana wird dann als das Aufgeben des Verlangens erklärt, das Leben für Leben zusammenhält. vāna, abgeleitet vom Wurzelwort vana, das auch „Wald, Wald“ bedeutet: Basierend auf dieser Wurzel wurde vana von buddhistischen Gelehrten metaphorisch so erklärt, dass es sich auf den „Wald der Verunreinigungen“ oder die fünf Aggregate bezieht; Nirvana bedeutet dann „Flucht aus den Aggregaten“ oder „frei von diesem Wald der Verunreinigungen“ sein.
Der Begriff Nirvana, „ausblasen“, wurde auch als Auslöschen der „drei Feuer“ oder „drei Gifte“ interpretiert, nämlich der Leidenschaft oder Sinnlichkeit (Raga), der Abneigung oder des Hasses (Dvesha) und der Täuschung oder Unwissenheit (moha oder avidyā).
Das „Ausblasen“ bedeutet nicht die völlige Vernichtung, sondern das Erlöschen einer Flamme. Der Begriff Nirvana kann auch als Verb verwendet werden: „er oder sie nirvāṇa-s“ oder „er oder sie parinirvānṇa-s“ (parinibbāyati).
Beliebte westliche Verwendung
LS Cousins sagte, dass Nirvana im Volksmund „das Ziel buddhistischer Disziplin“ sei, „die endgültige Beseitigung der störenden mentalen Elemente, die einen friedlichen und klaren Geisteszustand behindern, zusammen mit einem Zustand des Erwachens aus dem mentalen Schlaf, den sie hervorrufen.“ .
Zum Lösen
Ṭhānissaro Bhikkhu argumentiert, dass der Begriff nibbāna offenbar etymologisch aus dem negativen Präfix nir plus der Wurzel vāṇa oder binding (bindend) abgeleitet wurde und dass das zugehörige Adjektiv nibbuta (ungebunden) und das zugehörige Verb nibbuti (binden) ist. Er und andere verwenden den Begriff „unverbindlich“ für Nibbana. (Bhikku argumentiert, dass die frühe buddhistische Assoziation des Begriffs „Ausblasen“ mit dem Begriff „Ausblasen“ vor dem Hintergrund der damaligen Sicht auf die Prozesse des Feuers entstand – dass ein brennendes Feuer als heiß an seinem Brennstoff hängend angesehen wurde Aufregung, und dass das Feuer beim Erlöschen seinen Brennstoff losließ und einen Zustand der Freiheit, Abkühlung und des Friedens erreichte.
Beendigung des Webens des Geistes
Eine andere Interpretation von Nirvana ist das Fehlen des Webens (Vana) der Aktivität des Geistes.
Aufdecken
Matsumoto Shirō (1950-) aus der Gruppe des kritischen Buddhismus erklärte, dass die ursprüngliche etymologische Wurzel von Nirvana nicht als nir√vā, sondern als nir√vŗ, „aufdecken“ betrachtet werden sollte. Laut Matsumoto war die ursprüngliche Bedeutung von Nirvana daher nicht „auslöschen“, sondern „den Atman von dem freilegen, was Anatman (nicht Atman) ist“. Swanson gab an, dass einige Buddhismusgelehrte die Frage stellten, ob die Etymologien „Ausblasen“ und „Aussterben“ mit den Kernlehren des Buddhismus vereinbar seien, insbesondere über Anatman (Nicht-Selbst) und Pratityasamutpada (Kausalität). Sie sahen ein Problem darin, dass die Betrachtung von Nirvana als Auslöschung oder Befreiung voraussetzt, dass ein „Selbst“ ausgelöscht oder befreit wird. Andere buddhistische Gelehrte wie Takasaki Jikidō waren jedoch anderer Meinung und nannten den Matsumoto-Vorschlag „zu weit und ließe nichts übrig, was als buddhistisch bezeichnet werden könnte“.